Die Betroffene wurde bereits im Jahr 2020 wegen einer am 13.03.2019 begangenen mutmaßlichen Geschwindigkeitsüberschreitung (52 km/h außerorts, eine Vorahndung wegen Überschreitung um 35 km/h außerorts, rechtskräftig seit dem 02.03.2019) zu einer Geldbuße von 530 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot verurteilt. Das Urteil wurde vom Oberlandesgericht aufgehoben. Nach der Zurückverweisung sollte am 03.03.2021 die neue Hauptverhandlung stattfinden; der Termin wurde auf Bitten der Betroffenen auf Grund der damaligen Pandemielage in den Juni verschoben. Zu weiteren Verstößen durch die Betroffene kam es nicht.
Das AG ging von einer standardisierten Messung (mittels PoliScan FM1) aus und gelangte zu der gleichen Rechtsfolge wie in dem ersten Urteil. Von dem Regelfahrverbot sei auch angesichts der Dauer des Verfahrens (zwei Jahre und drei Monate seit dem Verstoß) nicht abzusehen. Besondere Härten gingen von dem Fahrverbot nicht aus. Zudem seien die Ursachen für die Verfahrensdauer der Betroffenen teilweise zuzurechnen: Diese habe trotz der im Gericht ergriffenen Schutzmaßnahmen lediglich allgemeine Bedenken gegen einen Verhandlungstermin im März 2021 auf Grund der Covid-19-Pandemie gehegt. Hinzukomme die von der Betroffenen eingelegte Rechtsbeschwerde, auf Grund der es zur Zurückverweisung der Sache an das Amtsgericht gekommen sei. Dies sei ihr zwar nicht im Sinne einer selbst verschuldeten langen Verfahrensdauer anzulasten. Andererseits sei nicht einzusehen, warum ein im Ergebnis erfolgloses Rechtsmittel und der dadurch verursachte Zeitablauf eine Milderung der Regelsanktion bewirken sollte, zumal eine andere Betrachtungsweise zu einem gewissen Missbrauch einladen könnte. Hinzukomme, dass die Betroffene durch die Verfahrensdauer nicht nennenswert belastet worden sei und dem Verstoß auf Grund der Vorahndung zusätzliches Gewicht zukomme.
AG Wittlich, Urteil vom 25.06.2021 – 36b OWi 8046 Js 27430/19
1. Die Betroffene wird wegen vorsätzlicher Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 52 km/h zu einer Geldbuße von 530,00 EUR verurteilt.
2. Ihr wird für die Dauer von einem Monat untersagt, im Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder Art zu führen. Das Fahrverbot wird erst wirksam, wenn der Führerschein nach Rechtskraft in amtliche Verwahrung gelangt ist, spätestens jedoch mit Ablauf von 4 Monaten seit Eintritt der Rechtskraft.
3. Die Betroffene trägt die Kosten des Verfahrens. Dies gilt auch für die Kosten der Rechtsbeschwerde.
Angewendete Vorschriften:
§§ 41 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2, 49 StVO; §§ 24, 25 StVG; § 4 Abs. 1, Nr. 11.3.8 Anlage BKatV.Gründe:
I.
(…)
II.
Die Hauptverhandlung hat aufgrund der gemäß dem Protokoll durchgeführten Beweisaufnahme zu folgenden Feststellungen geführt:
Am 13.03.2019 um … Uhr befuhr die Betroffene mit dem PKW, amtliches Kennzeichen …, die Bundesautobahn A 1, km 113,900, Gemarkung Salmtal, Fahrtrichtung Köln/Koblenz, wo eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h mit einem sog. Geschwindigkeitstrichter eingerichtet war.
Die Messstelle lag hierbei ca. 250 Meter hinter dem geschwindigkeitsregulierenden Verkehrszeichen Z 274 StVO, mit dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h beschränkt wurde. Die Beschilderung war beidseitig und gut -sichtbar am Fahrbahnrand angebracht. Bereits etwa 1200 m vor dieser Beschilderung wurde durch ebenfalls beidseitig und gut sichtbar angebrachte Verkehrszeichen Z 274 StVO die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h beschränkt; diese Verkehrszeichen waren durch das Zusatzzeichen „Straßenschäden” ergänzt. Nochmals hiervor befanden sich beidseitig und sichtbar entsprechende Verkehrszeichen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit bereits auf 130 km/h beschränkten.
Bei einer durch die ZVD Wittlich mittels eines gültig bis zum 31.12.2019 geeichten und entsprechend der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers von dem Messbeamten PTB … eingesetzten Geschwindigkeitsmessgerätes Poliscan FM 1, Seriennummer 775829 dort durchgeführten Geschwindigkeitsmessung wurde bei dem von der Betroffenen geführten Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 152 km/h (nach Toleranzabzug) ermittelt.
Obwohl die geschwindigkeitsbeschränkenden Verkehrszeichen, wie aufgezeigt, beidseitig aufgestellt und jeweils uneingeschränkt erkenn- und einsehbar waren, passierte die Betroffene die Messstelle mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 157 km/h. Nach Abzug einer Toleranz von 5 km/h des gemessenen Wertes ergab sich somit eine verfahrensrelevante Geschwindigkeit von 152 km/h sowie eine verfahrensrelevante Geschwindigkeitsüberschreitung von 52 km/h.
Die Betroffene überschritt vorsätzlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit.
III.
1.
Nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die Betroffene die ihr vorgeworfene Geschwindigkeitsüberschreitung begangen hat. Dies ergibt sich aus den Einlassungen der Betroffenen und ihres Verteidigers, den in der Hauptverhandlung zum Gegenstand gemachten Lichtbildern, dem Eichschein, der K0nformitätsbescheinigung, den Schulungsbescheinigungen des Messbeamten, dem Beschilderungsplan und dem zu der Geschwindigkeitsüberwachung gefertigten Messprotokoll.a) Die Betroffene hat die Fahrereigenschaft eingeräumt. Die Feststellungen zu ihrer Person beruhen auf ihrer Einlassung, diejenigen zu ihrer straßenverkehrsrechtlichen Vorbelastung auf dem Fahreignungsregisterauszug vom 04.06.2021.
b) Das Gericht ist darüber hinaus davon überzeugt, dass die Betroffene den Pkw zum Zeitpunkt der verfahrensgegenständlichen Messung vorsätzlich mit überhöhter Geschwindigkeit geführt hat.
aa) Dass sich der Streckenabschnitt der BAB 1 am Tattag wie oben beschrieben darstellte, ergibt sich aus dem Beschilderungsplan (Bl. 19 d. A.) sowie aus dem Messprotokoll (Bl. 10 d. A.) Danach wurden durch den Messbeamten vor und nach der Messreihe die örtlichen Gegebenheiten und insbesondere die Beschilderung auf deren Übereinstimmung mit den im Beschilderungsplan angegebenen Umfang kontrolliert und dies – soweit nach dem Formular erforderlich – auch in das gefertigte Messprotokoll eingetragen. Widersprüche zwischen dem Beschilderungsplan und dem ausgefüllten Messprotokoll sind nicht zutage getreten.
Zwar hat die Betroffene in der Hauptverhandlung ausgeführt, sie habe die Beschilderung hinsichtlich der Anzahl der geschwindigkeitsbeschränkenden Verkehrszeichen und/oder deren Abständen zueinander und/oder zum Messgerät anders in Erinnerung. In Anbetracht dessen, dass die Ausführungen der Betroffenen hierzu teilweise in sich widersprüchlich und unklar waren und dass ihre Erinnerung auch angesichts der langen Zeit zwischen Tattag und Hauptverhandlung nicht zwingend präzise ist, ergeben sich hieraus jedoch keine Zweifel an der anhand von Messprotokoll und Beschilderungsplan festgestellten Beschilderung.
bb) Die Geschwindigkeitsmessung selbst ist ordnungsgemäß durchgeführt worden. Sie erfolgte mittels des Geschwindigkeitsmessgeräts Vitronic PoliScan FM 1, Seriennummer 775829. Es handelt sich hierbei um ein von der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) geprüftes und zugelassenes, standardisiertes Messgerät (vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 17.10.2017, Az. 1 OWi 4 SsRs 129/17). Ausweislich des Eichscheins (Bl. 11 -12 d. A.) war das Gerät gültig bis zum 31. Dezember 2019 geeicht.
Der Messbeamte PTB … hat, wie aufgrund der Teilnahmebescheinigungen vom 27. März 2018 (Bl. 18 d. A.) und vom 29. September 2017 (Bl. 17 d.A.) ersichtlich ist, an den Seminaren “(ZF) Aufbaumodul Enforcement Trailer zum Geschwindigkeitsmessgerät 2045041 F81 0Z” sowie „Anwenderschulung für Poliscan FM1 zur Verwendung im mobilen Betrieb” teilgenommen. Dem in der Akte befindlichen Papierabzug des digitalen Messfotos (Bl. 9 d. A.) lassen sich die folgenden Messwerte entnehmen: Geschwindigkeit: 157 km/h, Limit PKW: 100 km/h. Das Foto weist zudem den Auswerterahmen hinreichend auf. Es befindet sich kein weiteres Fahrzeug innerhalb des Auswerterahmens, welches sich in gleicher Richtung bewegt. Zudem ist innerhalb des Auswerterahmens das Kennzeichen des Tatfahrzeugs sowie ein Teil des linken Vorderreifens erkennbar. Die untere Begrenzung des Auswerterahmens liegt unterhalb des Aufsatzpunktes der Vorderräder des Tatfahrzeugs auf dem Straßenbelag.
Gemäß dem in der Akte befindlichen Messprotokoll (Bl. 10 d. A.) in Verbindung mit dem in der Akte befindlichen Beschilderungsplan (Bl. 19 d. A.) befand sich die Messstelle ca. 250 m hinter den beidseitig am Fahrbahnrand angebrachten Verkehrszeichen Z 274 StVO, durch die die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt wurde, die im Abstand von ca. 1200 m auf entsprechende identische Verkehrszeichen folgten, die ihrerseits wiederum auf Verkehrszeichen mit der Anordnung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h folgten. Die Geschwindigkeitsuntergrenze des Messgeräts wurde für PKW auf 110 und für LKW auf 89 km/h eingestellt. Eichsiegel und Sicherungsmarken wurden vom Messbeamten überprüft. Das Messgerät wurde entsprechend der zur Tatzeit gültigen Bedienungsanleitung von geschultem Messpersonal aufgestellt, eingerichtet und in Betrieb genommen. Insbesondere sind keine Besonderheiten oder Auffälligkeiten im Messprotokoll vermerkt. Konkrete Anhaltspunkte für ein Versagen der Messtechnik oder einen Bedienungsfehler ergeben sich nicht. Ein Sachverständigengutachten war nicht erforderlich. Bei Geschwindigkeitsmessungen mit dem Gerät Poliscan handelt es sich um ein amtlich anerkanntes, standardisiertes Messverfahren (vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 17.10.2017, Az. 1 OWi 4 SsRs 129/17), so dass der konkrete Messvorgang einer sachverständigen Begutachtung nur bei konkreten Anhaltspunkten für eine Fehlmessung unterzogen werden muss. Standardisiert ist ein Messverfahren stets, wenn die Ermittlung des Messwerts nach einem durch Normen vereinheitlichten (technischen) Verfahren erfolgt, bei dem die Voraussetzungen seiner Anwendbarkeit und sein Ablauf so präzise festgelegt sind, dass unter gleichen Bedingungen gleiche Ergebnisse erwartet werden können.
Dies bewirkt, dass die Ermittlungsbehörden und die Gerichte im Regelfall von einer sachverständigen Prüfung freigestellt sind, es sei denn, der konkrete Einzelfall gibt dazu Veranlassung. Diesen Anforderungen entspricht das vorliegend eingesetzte Messgerät PoliScan FM1; zudem wurde es ausweislich des Messprotokolls von dem die Messung durchführenden und entsprechend geschulten Beamten ordnungsgemäß und der Gebrauchsanleitung des Herstellers entsprechend aufgebaut, eingerichtet und eingesetzt.
Aus der Konformitätsbescheinigung ergibt sich nach neuem Recht das Gleiche wie aus der Bauartzulassung nach altem Recht. Grundlage ist in beiden Fällen das Ergebnis der eingehenden Prüfung eines Gerätemusters durch eine anerkannte Stelle. Diese führt umfangreiche Tests durch um festzustellen, ob das Gerät, so wie es vom Hersteller vorgestellt wurde, allen Anforderungen genügt, die sich aus dem Messrecht ergeben. Dazu gehören auch Vergleichsmessungen in sehr großer Zahl, die an Referenzstrecken auf öffentlichen Straßen durchgeführt werden. Nur wenn keine einzige Abweichung vom wahren Wert außerhalb der Verkehrsfehlergrenzen liegt, wird das Gerät als messrechtskonform qualifiziert (OLG Koblenz, Beschluss vom 20.11.2018, Az. 1 OWi 6 SsRs 179/18). Insoweit ändert auch das neue Eichrecht nichts an der Einstufung des vorliegend verwendeten Messverfahrens als „standardisiertes Verfahren”.
2.
Die Verwertung der Messdaten hinderte auch nicht der hiergegen vom Verteidiger in der Hauptverhandlung erklärte Widerspruch, den er damit begründete, dass die Rohmessdaten bereits während der Verarbeitung durch das Messgerät wieder gelöscht wurden. Auch das Recht auf ein faires Verfahren gebietet nicht, diese Daten für die Zwecke späterer Analyse bereitzuhalten. Es liegt ein standardisiertes Messverfahren vor, in dem ein Messgerät eingesetzt wurde, dessen geprüfte und zugelassene Funktionsweise es nicht vorsieht, Rohmessdaten dauerhaft zu speichern. Dem steht auch nicht der Beschluss des BVerfG vom 12.11.2020 (2 BvR 1616/18) entgegen; dieser gebietet lediglich die Herausgabe von bei den Behörden tatsächlich vorhandenen Rohmessdaten.3.
Die Betroffene hat die Geschwindigkeitsüberschreitung als möglich erkannt und den Erfolg billigend in Kauf genommen.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass ordnungsgemäß aufgestellte Verkehrszeichen von Verkehrsteilnehmern gesehen werden (BGH vom 11.09.1997, Az 4 StR 638/96). Hat sich ein Verkehrsteilnehmer vom Verkehr abgewandt und nimmt infolgedessen die ge- bzw. verbotsregelnden Zeichen nicht mehr wahr, so nimmt er Verstöße hiergegen billigend in Kauf (BGH a.a.O.). Die Möglichkeit, dass ein Kraftfahrer ein Zeichen übersehen hat, braucht nur dann in Rechnung gestellt zu werden, wenn sich hierfür konkrete Anhaltspunkte ergeben oder der Betroffene dies im Verfahren einwendet (OLG Koblenz, Beschluss vom 26.08.2013, 2 SsBs 128/12 m. W. N.). Dies gilt erst recht, wenn – wie hier – die Beschilderung beidseitig mehrfach vorhanden und die Baustelle durch Verkehrsschilder angekündigt ist, so dass die vorbeikommenden Fahrzeugführer über die allgemein erforderliche Aufmerksamkeit hinaus besonders für (weitere) Verringerungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sensibilisiert sind.
Hieran begründen auch die Ausführungen der Betroffenen, sie habe die Beschilderung hinsichtlich der Anzahl der geschwindigkeitsbeschränkenden Verkehrszeichen und/oder deren Abständen zueinander anders in Erinnerung als vom Gericht angenommen, keine Zweifel. Diese Ausführungen sind wenig klar und von der Betroffenen nicht mit Sicherheit vorgetragen. Schon vor Erreichen der Messstelle musste die Betroffene durch die Gesamtheit der Beschilderung – selbst wenn sie eines der Verkehrszeichen nicht wahrgenommen haben sollte – es jedenfalls für möglich halten, nahm es aber dennoch billigend in Kauf, dass eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit gilt. Dies gilt umso mehr, als die Betroffene trotz Unklarheiten in ihrer Schilderung einräumt, Beschränkungen der Höchstgeschwindigkeit sowohl auf 130 km/h als auch auf 100 km/h wahrgenommen zu haben.
Nicht folgen konnte das Gericht auch ihrer Einlassung, sie habe bei Erkennen der Geschwindigkeitsbeschränkung begonnen zu bremsen, hierbei eine Intervallbremsung angewendet, um die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten, und es sei dadurch nicht möglich gewesen, bis zur Messstelle weiter als auf die letztlich gemessene Geschwindigkeit herunterzubremsen. Es ist bereits fernliegend, dass die Betroffene, die nach eigenem Bekunden eine routinierte Autofahrerin ist und zur Tatzeit ein nur wenige Jahre altes, mit Antiblockiersystem ausgestattetes Fahrzeug regelmäßig nutzte, eine Intervallbremsung (“Stotterbremse”) vornahm. Diese Art der Bremsbetätigung ist nur bei Fahrzeugen ohne Antiblockiersystem bei äußerst starken (Gefahr-)Bremsungen sinnvoll, um zu vermeiden, dass die Räder blockieren und das Fahrzeug so unbeherrschbar wird, und wird daher bereits seit Jahrzehnten für jeweils aktuelle Fahrzeuge nicht mehr empfohlen. Ob diese Methode für Bremsungen mittlerer Intensität – wie man sie beim raschen Verringern der Geschwindigkeit im Autobahnverkehr in der Regel anwendet, da ein Bremsen mit größtmöglicher Intensität in dieser Situation mit Blick auf mögliche Auffahrunfälle höchst gefährlich und daher ohnehin ungeeignet wäre – überhaupt jemals empfohlen wurde, erscheint jedenfalls zweifelhaft. Selbst wenn man unterstellt, dass die Betroffene tatsächlich eine Intervallbremsung vornahm und dadurch ihr Fahrzeug nur mäßig stark verzögerte, erscheint ihre Einlassung nicht plausibel. Die Betroffene führte aus, nicht erst bei dem letzten geschwindigkeitsregelnden Verkehrszeichen – ca. 250 m vor dem Messgerät – den Bremsvorgang begonnen zu haben, sondern schon bei einem der vorangegangenen Verkehrszeichen. Wenn sie, aber schon in größerem Abstand vor dem Messgerät die Bremsung eingeleitet hätte und bis dahin nach eigenem Bekunden mit rund 180 km/h fuhr, ist unabhängig von einer bestimmten Technik des Bremsens nicht nachvollziehbar, wieso es nicht möglich gewesen soll, weiter als nur bis auf 152 km/h zu verzögern.
Bei einer qualifizierten Geschwindigkeitsüberschreitung um mindestens 40 km/h erschließt sich dem Fahrer grundsätzlich auch bereits aus den sensorischen Eindrücken, z.B. durch Motorengeräusch, Fahrzeugvibration und Schnelligkeit der Veränderung der Umgebung die Möglichkeit einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung; diese muss sich dem Betroffenen aufdrängen, so dass ein weiteres beweiskräftiges Indiz gegeben ist, das für eine vorsätzliche Tatbegehung spricht (OLG Koblenz vom 26.08.2013 – 2 SsBs 128/12; OLG Hamm vom 10.05.2016 – III- 4 RBs 91/16, OLG Hamm vom 10.05.2016 – III – 4 RBs 91/16, OLG Koblenz 2 OWI 6 SsBs 194/18). Die Schnelligkeit, mit der sich die Umgebung um die Betroffene herum geändert hat, musste ihr die Erkenntnis vermitteln, dass die erlaubte Geschwindigkeit wesentlich überschritten wurde. Den Verkehrsverstoß hat sie zumindest billigend- in Kauf genommen. Anhaltspunkte für ein Augenblicksversagen liegen nicht vor; sie werden von der Betroffenen auch nicht vorgetragen.
4.
Weder Zweifel an der Richtigkeit der dargestellten Messung noch das Erfordernis, die Sache von Amts wegen weiter aufzuklären, weitere Beweise zu erheben oder das Verfahren zwecks Gelegenheit zu weiterer Vorbereitung der Verteidigung auszusetzen, ergaben sich aus den Anträgen der Verteidigung.Beantragt wurden namentlich – neben weiteren Anträgen, denen das Gericht stattgegeben hat – die Zurverfügungstellung der Falldatensätze der gesamten Messreihe mit Statistikdateien und Caselists, einer Bedienungsanleitung für den Enforcement Trailer, in dem das Messgerät eingebaut war, auf dem zur Zeit der Hauptverhandlung aktuellen Stand, sowie der verkehrsrechtlichen Anordnung der Geschwindigkeitsbeschränkung. Diese Anträge waren abzulehnen, da eine dahingehende Beweiserhebung zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich war, § 77 Abs. 2 Nr. 1 OWiG; eine Beiziehung dieser Materialien ist weder unter Aufklärungsgrundsätzen noch aus dem Recht auf ein faires Verfahren geboten. Da eine Überprüfung der Zuverlässigkeit von Messungen, die mit einem standardisierten Messverfahren gewonnen worden sind, nur dann angezeigt ist, wenn sich konkrete Tatsachen ergeben, die geeignet sind, Zweifel an der Richtigkeit des Messergebnisses zu wecken (st. Rspr. seit BGH, Beschluss vom 19.08.1993, 4 StR 627/92 = BGHSt 39, 291 , 297; s. OLG Koblenz, Beschluss vom 27.02.2018, 1 OWi 6 SsRs 19/18 m.w.N.), ist die Beiziehung und Auswertung weiterer Daten und Unterlagen nur dann veranlasst, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich aus derartigen Daten oder ihrer sachverständigen Untersuchung Umstände ergeben, welche die Richtigkeit der verfahrensgegenständlichen Messung in Frage stellen (OLG Koblenz, Beschluss vom 27.02.2018, 1 OWi 6 SsRs 19/18). Solche sind vorliegend nicht ersichtlich.
Was die beantragte Beiziehung der Falldaten, Statistikdateien und Caselists der gesamten Messreihe betrifft, ist die Aussagekraft der Daten über die Messungen anderer Verkehrsteilnehmer für die Messung des Betroffenen nicht ersichtlich. Selbst wenn beispielsweise andere Messungen auffallend häufig vom Messgerät als unbrauchbar verworfen worden wären, ergäbe sich daraus kein Hinweis darauf, dass die gerade nicht vom Gerät verworfene Messung des Betroffenen im Wahrheit fehlerhaft ist (vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 17.11.2020, 1 OWi 6 SsRs 271/20). Welche Relevanz die Bedienungsanleitung für den Enforcement Trailer auf dem zur Zeit der Hauptverhandlung aktuellen Stand für das Verfahren haben soll, ist nicht nachvollziehbar. Die entsprechende Anleitung auf dem zur Zeit der Messung aktuellen Stand wurde der Verteidigung zur Verfügung gestellt. Aus einer neueren Version der Anleitung ließe sich nichts über die zur Zeit der Messung aktuellen technischen Merkmale des Trailers und die zu dieser Zeit ordnungsgemäße Bedienung entnehmen.
Schließlich war auch nicht die Beiziehung oder Zurverfügungstellung der verkehrsrechtlichen Anordnung der verfahrensgegenständlichen Geschwindigkeitsbeschränkung geboten. Wesentlich für die Ahndung einer Verkehrsordnungswidrigkeit ist die Frage, wie sich die Beschilderung zur Tatzeit darstellte, das heißt, welche Verkehrszeichen wo vorhanden waren und inwiefern diese erkennbar waren. Diese Frage hat die durchgeführte Beweiserhebung hinlänglich beantwortet. Zudem kann eine verkehrsrechtliche Anordnung keine weitergehenden Erkenntnisse über die tatsächlich vorhandene Beschilderung liefern. Sollte ein relevantes Verkehrszeichen rechtswidrig sein, müsste es dennoch beachtet werden und wäre grundsätzlich nicht nichtig (vgl. § 44 Abs. 1 VwVfG Bund i. V. m. § 1 Abs. 1 LVwVfG RLP). Aussagekräftig ist eine verkehrsrechtliche Anordnung letztlich nur für die Frage, ob ein Verkehrszeichen überhaupt auf eine behördliche Anordnung zurückgeht (und nicht etwa als bloßer Scheinverwaltungsakt willkürlich durch einen Privaten aufgestellt wurde). Dass diese Frage sich vorliegend ernsthaft stellt und eine dahingehende Aufklärung geboten ist, ist aber nicht ersichtlich und auch nicht von der Verteidigung vorgebracht (vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 17.11.2020, 1 OWi 6 SsRs 271/20).
5.
Ebenso wenig war die Einstellung des Verfahrens gemäß § 47 Abs. 2 OWiG angezeigt oder gar ein Verfahrenshindernis gegeben. Der Verteidiger hatte die Einstellung mit Verweis auf mehrere Besonderheiten im Verfahren beantragt. Diese (vermeintlichen) Besonderheiten haben sich jedoch nicht auf die Messung als solche ausgewirkt und auch nicht anderweitig in – gemessen an dem relativ gravierenden vorliegenden Verkehrsverstoß – erheblicher Weise in die Rechte der Betroffenen eingegriffen.Die Verteidigung rügt, dass die Verwaltungsbehörde bereits einen Fahreignungsregisterauszug hinsichtlich der Betroffenen eingeholt hat, als sie prüfte, aber noch nicht den konkreten Entschluss gefasst hatte, diese als Betroffene zu verfolgen. Die Einholung dieses Auszugs zu einem Zeitpunkt, in dem diese (noch) nicht erforderlich war, mag über das Erforderliche hinausgehen und daher, wie vom Verteidiger vorgebracht, datenschutzwidrig sein. Doch ist hiermit allenfalls in sehr geringem Maß in die Rechte des Betroffenen eingegriffen worden, da wenig später, nämlich sobald die Verwaltungsbehörde die Betroffene als Fahrerin zur Tatzeit ansehen durfte, ebendiese Auskunft über sie eingeholt werden durfte und musste (vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 29.03.2021, 3 OWi 6 SsBs 57/21 ). Dies gilt entsprechend auch für einen weiteren von der Verteidigung angenommenen Datenschutzverstoß, der darin liegen soll, dass die durch die Verwaltungsbehörde vor Erlass des Bußgeldbescheids grundsätzlich zulässigerweise eingeholte Einwohnermeldeamtsauskunft hinsichtlich der Betroffenen für das Bußgeldverfahren nicht unbedingt erforderliche Daten wie den Familienstand umfasste.
Gleichermaßen für das Verfahren letztlich nicht relevant ist der von der Verteidigung angenommene zu geringe Abstand des Messgeräts (im Enforcement Trailer) zur Fahrbahn beziehungsweise zur Leitplanke. Ein Verstoß gegen die Bedienungsanleitung des Messgeräts sowie Auswirkungen des genauen Aufstellorts auf die Messrichtigkeit sind nicht ersichtlich und auch von der Verteidigung nicht angeführt. Sollte das Messgerät näher an der Fahrbahn aufgestellt worden sein, als behördeninterne Richtlinien dies vorsehen, mag dies die Gefahr für die Insassen eines aus sonstigen Gründen von der Fahrbahn abkommenden und mit dem Messgerät kollidierenden Fahrzeugs erhöhen. Im vorliegenden Fall ist ein wie auch immer gearteter von dem genauen Aufstellort des Messgeräts ausgehender Nachteil für die Betroffene aber nicht ersichtlich. Auch steht – entgegen der Auffassung der Verteidigung – einer Verwertung der Messdaten insoweit nichts entgegen.
IV.
Der Betroffene hat danach vorsätzlich eine Ordnungswidrigkeit, nämlich die Überschreitung der durch § 41 Abs. 1 StVO in Verbindung mit Zeichen 274 gemäß Anlage 2 StVO auf 100 km/h begrenzten Höchstgeschwindigkeit um 52 km/h (nach Toleranzabzug) außerhalb geschlossener Ortschaften begangen (§ 41 Abs. 1, Anlage 2, § 49 StVO, 24 StVG).
V.
1.
Für fahrlässig begangene Geschwindigkeitsüberschreitungen von 52 km/h sieht der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog (Nr. 11.3.8) eine Geldbuße von 240,00 EUR vor. Im Falle des Vorsatzes kommt es zu einer Verdoppelung der Geldbuße auf 480,00 EUR (§ 3 Abs. 4a BKatV). Die Bußgeldkatalogverordnung geht bei der Bemessung der Regelgeldbuße jedoch von einer bislang nicht einschlägig in Erscheinung getretenen Betroffenen aus (vgl. § 3 Abs. 1 BKatV). Dies ist vorliegend nicht der Fall; das Gericht hat daher die Geldbuße aufgrund der oben genannten Voreintragung um 50,00 EUR, mithin knapp 10 %, erhöht. Der Betroffenen muss nachhaltig vor Augen geführt werden, dass verkehrsrechtliche Bestimmungen v.a. auch im Interesse anderer Verkehrsteilnehmer eingehalten werden müssen. Unter Abwägung dieser Umstände hält das Gericht in Übereinstimmung mit dem vorher Gesagten im vorliegenden Fall eine Geldbuße in Höhe von insgesamt 530,00 EUR für angemessen.Die Betroffene ist – auch in der Lage, diese Geldbuße zu bezahlen. Sie lebt nach eigenem Bekunden in sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Bedenken hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bestehen nicht.
2.
Gegen die Betroffene war darüber hinaus ein einmonatiges Fahrverbot zu verhängen, da die Geschwindigkeitsüberschreitung gemäß §§ 25 Abs. 1 StVG, 4 BKatV unter grober Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen wurde.Nach den Regelsätzen des Bußgeldkatalogs ist bereits bei einer fahrlässigen Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften von einem einmonatigen Fahrverbot auszugehen. Vorliegend erfolgte eine vorsätzliche Geschwindigkeitsüberschreitung um 52 km/h.
Anhaltspunkte dafür, dass der mit dem Fahrverbot erstrebte Besinnungs- und Erziehungseffekt auch durch die Erhöhung der Geldbuße unter gleichzeitigem Wegfall des Fahrverbots erreicht werden könnte, liegen nicht vor. Die Betroffene hat die Höchstgeschwindigkeit vorsätzlich überschritten. Dies zeigt bereits, dass der angestrebte Besinnungs- und Erziehungseffekt allein durch eine Erhöhung der Geldbuße nicht erreicht werden kann. Auf den Kreis der Vorsatztäter sind erhöhte Geldbußen erfahrungsgemäß ohne Wirkung (BGH NJW 1992, 449).
Die im Bußgeldkatalog bestimmten Fälle grober Verkehrsverstöße sind gesetzlich als derart schwerwiegend vorbewertet, dass im Regelfall die Verhängung eines Fahrverbots auch angemessen erscheint. Für eine Einzelfallprüfung, ob trotz des Vorliegens der Voraussetzungen eine grobe Pflichtverletzung zu verneinen ist, ist danach nur mehr eingeschränkt Raum (vgl. BayObLG, Beschluss vom 24.11 .1999, 2 ObOWi 558/99). Von der Anordnung eines Fahrverbots kann in diesen Fällen im Einzelfall nur abgesehen werden, wenn Umstände gegeben sind, die das Tatgeschehen aus dem Rahmen der typischen Begehungsweise einer solchen Ordnungswidrigkeit im Sinne einer Ausnahme herausheben oder Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass ein Fahrverbot mit dem verfassungsrechtlichen Übermaßverbot nicht vereinbar ist. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.
Solch eine besondere Härte hat die Rechtsprechung z.B. bei einer beruflichen Härte ganz außergewöhnlicher Art, wie dem Existenzverlust eines Selbstständigen oder dem Arbeitsplatzverlust eines Arbeitnehmers, bejaht. Nach der Überzeugung des Gerichts ist es der Betroffenen vorliegend aber durchaus möglich und zumutbar, sich auf ein lediglich einmonatiges Fahrverbot einzurichten – zumal die viermonatige „Schonfrist” eingeräumt werden konnte und die Verbotsfrist daher für sie planbar ist – und durch Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxifahrten, durch Unterstützung von Familie, Freunden und Bekannten diese Zeit zu überbrücken. Sie ist nicht mehr berufstätig, unterrichtet allerdings in gewissem Umfang bei Weiterbildungen, wozu sie jedoch erst nach Abklingen der COVID-19-Pandemie wieder in nennenswertem Umfang Termine außer Haus wahrnehmen muss. Im Übrigen fährt sie zu privaten Zwecken, teilweise auch zur Unterstützung von Verwandten und Bekannten. Dies steht einem Fahrverbot nicht entgegen. Soweit unverhältnismäßige Auswirkungen auf die durch die Betroffene unterstützten Personen überhaupt hinsichtlich eines Fahrverbots zu berücksichtigen sein sollten, sind solche Auswirkungen nicht anzunehmen, da – wenn es keine andere Lösung gibt – die Betroffene angesichts ihrer guten wirtschaftlichen Lage auch hierfür fraglos auf Taxifahrten zurückgreifen kann.
Im Übrigen bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der mit dem Fahrverbot erstrebte Besinnungs- und Erziehungseffekt durch eine Erhöhung der Geldbuße unter gleichzeitigem Wegfall des Fahrverbots erreicht werden könnte (BGH NJW 1992, 449). Hierbei sind auch die Voreintragungen zu berücksichtigen. Straßenverkehrsrechtlich ist die Betroffene bereits durch eine nur etwa zwei Monate vor der hiesigen Tat begangene Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 35 km/h in Erscheinung getreten. Das Fahrverbot soll nach dem Willen des Gesetzgebers als eindringliches Erziehungsmittel wirken. Grundsätzlich wird hierdurch jeder in gleicher Weise betroffen. Schließlich gilt es, Leib, Leben und körperliche Unversehrtheit sowie sonstige hochwertige Rechtsgüter einer Vielzahl von anderen Verkehrsteilnehmern zu bedenken. Die Allgemeinheit hat ein besonderes Interesse daran, regelwidrig fahrende Verkehrsteilnehmende zu einer besonneneren Fahrweise zu bewegen.
3.
Schließlich erforderte auch die Dauer des Verfahrens kein Absehen vom Regelfahrverbot. Zwischen der Begehung der Ordnungswidrigkeit und dem Urteil liegen zwei Jahre und drei Monate. Eine lange Verfahrensdauer gebietet nicht automatisch das Absehen vom Fahrverbot (vgl. etwa OLG Brandenburg, Beschluss vom 25.02.2020, (1 B) 53 Ss-OWi 708/19 (405/19); OLG Koblenz, Beschluss vom 02.10.2009, 2 SsBs 100/09). Grundsätzlich kann eine Verkürzung des Fahrverbots kann eine angemessene Reaktion auf eine lange Verfahrensdauer sein (vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 25.02.2020, (1 B) 53 Ss-OWi 708/19 (405/19)). Bei einem Fahrverbot von einem Monat ist dies aber nicht möglich; § 25 Abs. 1 Satz 1 StVG ordnet eine Mindestdauer des Fahrverbots von einem Monat an. Das Gericht konnte somit nur zwischen einem Fahrverbot von (mindestens) einem Monat und einem völligen Wegfall des Fahrverbots wählen.Geboten mag es sein, bei langer Verfahrensdauer und Unmöglichkeit der Verkürzung des Fahrverbots (wegen des Mindestmaßes von einem Monat) jedenfalls die grundsätzlich sehr hohen Hürden für ein Absehen vom Fahrverbot wegen persönlicher Härten in gewissem Maß zu senken. Hier sind aber keine derartigen Härten greifbar, die das Fahrverbot für die Betroffene bedeuten würde.
Zu berücksichtigen ist auch, inwiefern die Ursachen für die lange Verfahrensdauer der Betroffenen zuzurechnen sind (vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 02.10.2009, 2 SsBs 100/09). Im vorliegenden Verfahren hatte das Amtsgericht im zweiten Rechtsgang Hauptverhandlungstermin auf den 03.03.2021 bestimmt, so dass ein Urteil noch vor Ablauf von zwei Jahren seit der Tat hätte ergehen können und sich somit nach überwiegender Auffassung die Frage eines Absehens vom Fahrverbot im Hinblick auf die Verfahrensdauer nicht einmal gestellt hätte. Eine Verhinderung des Verteidigers am 03.03.2021 erforderte zwar eine Verlegung, die aber auf einen sehr zeitnahen Ausweichtermin hätte erfolgen können. Die Verschiebung um über drei Monate auf den tatsächlich durchgeführten Hauptverhandlungstermin am 09.06.2021 (mit Fortsetzung am 25.06.2021) erfolgte allein aufgrund einer Bitte der Betroffenen, die die Verteidigung an das Gericht herantrug. Das Gericht gab dieser Bitte statt, wobei es bereits darauf hinwies, dass nicht beabsichtigt ist, diese Verfahrensverzögerung zum Vorteil der Betroffenen in der Sache zu berücksichtigen. Einen außerhalb der Sphäre der Betroffenen liegenden wichtigen Grund für diese Verschiebung gab es nicht. Der Wunsch der Betroffenen nach dieser Verschiebung wurde mit – trotz aller im Gericht ergriffenen Schutzmaßnahmen bestehenden – allgemeinen Bedenken hinsichtlich der COVID-19-Pandemie begründet. Jedoch wurden keine konkreten dahingehenden Umstände erkennbar, aus denen es der Betroffenen einerseits nicht zumutbar gewesen wäre, an einer Hauptverhandlung im März 2021 teilzunehmen, andererseits aber doch offensichtlich problemlos möglich war, an zwei Hauptverhandlungsterminen im Juni 2021 – sowie bereits im ersten Rechtsgang an einem Hauptverhandlungstermin im Juni 2020 – teilzunehmen.
Eine weitere Ursache für die Verfahrensdauer ist die Rechtsbeschwerde der Betroffenen im ersten Rechtsgang, aufgrund derer die Sache an das Amtsgericht zurückverwiesen wurde. Die zulässige Ausübung von Verteidigungsrechten und die Wahrnehmung des Instanzenzugs sind der Betroffenen zwar nicht im Sinne einer selbst verschuldeten langen Verfahrensdauer anzulasten. Andererseits ist nicht einzusehen, warum ein im Ergebnis für die Betroffene erfolgloses Rechtsmittel – erfolglos in dem Sinn, dass es kein vom ersten Rechtsgang abweichendes Urteil des Erstgerichts im zweiten Rechtsgang vorgezeichnet hat – und der dadurch verursachte Zeitablauf eine Milderung der Regelsanktion erfordern sollte. Sähe man dies anders, könnte dies zu einem gewissen Missbrauch einladen: Wer von seiner Verteidigung dahingehend beraten wird und wen die Verfahrenskosten nicht abschrecken – etwa aufgrund einer sehr guten wirtschaftlichen Situation oder weil ein Versicherer dafür aufkommt-, könnte motiviert sein, Rechtsbeschwerde (die bei Verhängung eines Fahrverbots nie der Zulassung bedarf, § 79 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 OWiG) einzulegen, selbst wenn dies kaum erfolgversprechend scheint. So könnte man im Ergebnis – wenn die Rechtsbeschwerde etwa wegen eines geringfügigen Verfahrensmangels begründet ist, der in zweiten Rechtsgang abgestellt wird und in der Sache keine andere Entscheidung als im ersten Rechtsgang verlangt – durch erhöhten finanziellen Aufwand ein Fahrverbot umgehen. Dies stünde in klarem Widerspruch zur restriktiven Rechtsprechung (gerade auch des OLG Koblenz), die ein Absehen vom Fahrverbot selbst gegen erhebliche Erhöhung der Geldbuße nur in Ausnahmefällen zulässt. Zudem wäre es unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit bedenklich, wenn allein ein durch eine kundige, gegebenenfalls aufwändige Verteidigung länger dauerndes Verfahren bei identischer Sachlage zu einer Verschonung vom Fahrverbot führen würde (siehe auch Metzger, NZV 2005, 178 (179)). Anzufügen ist die Erwägung, dass die Fortdauer des Verfahrens als solche – anders als beispielsweise in Fällen, in denen der Beschuldigte beziehungsweise Angeklagte in einem Strafprozess sich in Untersuchungshaft befindet – in aller Regel die Betroffene während dieser Zeit nicht nennenswert belastet.
Vom Fahrverbot abzusehen war auch nicht unter dem Aspekt, dass es aufgrund der Verfahrensdauer nicht mehr zu Erziehungszwecken beziehungsweise als Denkzettel wirken könnte. In der Tat ist die Betroffene nach der über zwei Jahre zurückliegenden verfahrensgegenständlichen Ordnungswidrigkeit straßenverkehrsrechtlich nicht weiter in Erscheinung getreten. Doch ist dies eher als der Regelfall denn als entlastender, ein Absehen vom Fahrverbot gebietender Sonderfall anzusehen. Ohnehin ist in den meisten Bußgeldverfahren, die nach Einspruch vor dem Amtsgericht verhandelt und entschieden werden, der Zeitraum zwischen der Begehung der Ordnungswidrigkeit und der Durchführung des (nicht selten gemäß § 25 Abs. 2a StVG nochmals um bis zu vier Monate verschobenen) Fahrverbots deutlich länger, als dass man noch von einem “auf dem Fuße folgenden” Denkzettel sprechen könnte, und auch dies stellt nicht generell den Sinn des Fahrverbots als erzieherisches Mittel in Frage.
Dass ein Fahrverbot nach langer Verfahrensdauer nicht wegen seiner möglicherweise eingeschränkten erzieherischen Wirkung obsolet ist, gilt umso mehr, als der Erziehungsgedanke nur einer von mehreren Aspekten ist, auf die sich die Verhängung eines Fahrverbots stützt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist hierbei die Schwere des zu sanktionierenden Verstoßes (vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 02.10.2009, 2 SsBs 100/09; vgl. auch § 25 Abs. 1 S. 1 StVG: ein Fahrverbot kann bei „grober oder beharrlicher Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers” verhängt werden). In diesem Zusammenhang spricht hier zusätzlich gegen ein Absehen vom Fahrverbot, dass nicht nur die verfahrensgegenständliche Geschwindigkeitsüberschreitung allein bereits deutlich über der Schwelle zum einmonatigen Regelfahrverbot (41 km/h) liegt, sondern darüber hinaus die Voraussetzungen eines „Wiederholer-Regelfahrverbots” gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 BKatV erfüllt sind. Selbst wenn der verfahrensgegenständliche Verstoß deutlich geringer wäre, als er tatsächlich ist – konkret: wenn die Überschreitung nicht bei 52 km/h, sondern lediglich im Bereich von 26 bis 40 km/h läge-, wäre vorliegend in der Regel ein einmonatiges Fahrverbot festzusetzen, da der Verstoß innerhalb eines Jahres – gerade einmal elf Tage – nach rechtskräftiger Festsetzung einer Geldbuße wegen einer anderen Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wurde.
Hinter dem Bußgeldkatalog mit seinen Regel-Bußgeldsätzen und -Fahrverboten steht zudem der Gedanke, dass gleichartige Verstöße gleichmäßig sanktioniert werden sollen. Dies spricht dafür, Personen, die gleichartige Verstöße begehen, auch hinsichtlich der Sanktionierung durch ein Fahrverbot gleich zu behandeln, und zwar – Sonderfälle wie die bereits angesprochenen ausgenommen – unabhängig vom Verfahrensablauf (so auch Metzger, NZV 2005, 178 (179)). Umgekehrt spricht es dagegen, völlig vom Fahrverbot abzusehen, zumal kein Verstoß an der untersten Grenze der überhaupt mit einem, Regelfahrverbot belegten Fälle vorliegt. Eine letztendliche Gleichbehandlung mit deutlich geringeren Verkehrsverstößen, für die kein Regelfahrverbot gilt, ist hier nicht angezeigt.
4.
Die Viermonatsfrist nach § 25 Abs. 2a StVG für den Beginn der Wirksamkeit des Fahrverbots war zu gewähren. Gegen die Betroffene ist weder in den zwei Jahren vor der verfahrensgegenständlichen Ordnungswidrigkeit noch bis zur hiesigen Entscheidung ein Fahrverbot verhängt worden.VI.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 46 Abs. 1 OWiG, 465 Abs. 1, § 473 Abs. 1 S. 1 StPO.
Mitgeteilt von Rechtsanwälte Zimmer-Gratz, Bous.



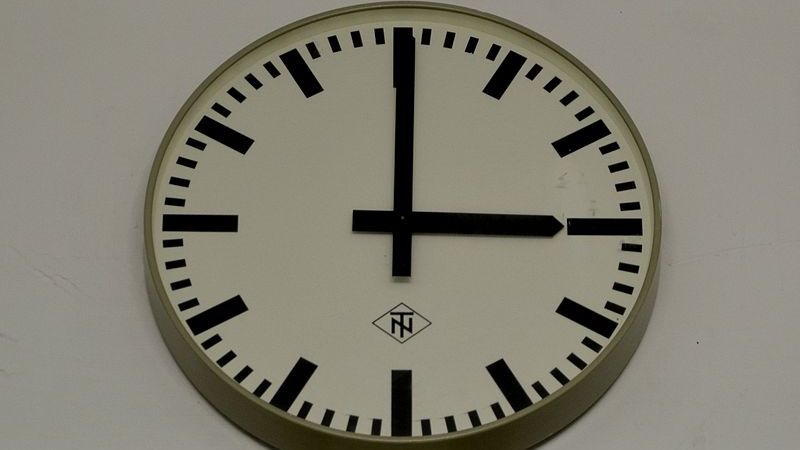
Einen Kommentar schreiben